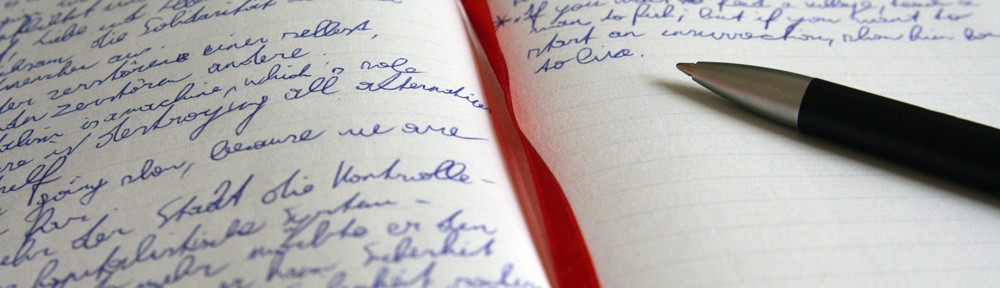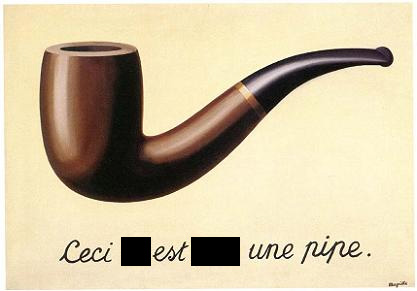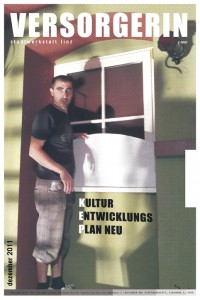Nach meinem gestrigen Artikel zu den anscheinend geplanten Kürzungen im freien Kunst- und Kulturbetrieb habe ich auch einen offenen Brief (okay, eine offene E-Mail) an SPÖ-Kulturministerin Claudia Schmied verfasst:
Sehr geehrte Frau Ministerin Schmied,
in den letzten Tagen wurden zahlreiche Details des kommenden Sparpakets publik. Manche der Vorschläge finde ich nachvollziehbar, doch eines ist offensichtlich: Die breite Bevölkerung und die sozial Schwächsten müssen die Kosten bezahlen, die nicht durch den Sozialstaat, sondern durch die höchst ungleiche Vermögensverteilung in Österreich entstehen.
Als Künstler und Kulturarbeiter bin ich besonders über zwei kolportiere Vorschläge entsetzt:
1. Die Kürzung der Ermessensausgaben in Höhe von 5-15%
Wie Sie sicher wissen, ist ein Großteil der Kulturförderung der unabhängigen Kunst- und Kulturszene Österreichs in den Ermessensausgaben angesiedelt. Nicht nur Basissubventionen, besonders auch Projektförderungen, Sonderfördertöpfe wären betroffen. Werden diese Budgetposten um 5-15% gekürzt, wird diese Kürzung direkt auf die Einkommen der österreichischen KünstlerInnen durchschlagen.
2. Die Umstellung der Förderaufteilung zwischen den Gebietskörperschaften
In Österreich ist es Usus, dass Kulturvereine Subventionen von Stadt, Land und Bund beziehen. Auch wenn diese Förderpraxis einiges an Mehrarbeit bedeutet, hat sie allerdings den Vorteil, dass die KIs nicht vom Wohlwollen einer einzigen Förderstelle und den dort herrschenden politischen Machtverhältnissen abhängig sind. Ebenfalls wird die Umstellung auf eine Förderpyramide, bei der der Bund erst ab einem gewissen Gesamtbetrag fördert, besonders die vielen kleinen Kunst- und Kulturvereine treffen. Wenn sich FörderwerberInnen nur noch an eine Förderstelle wenden können, sind sie dieser auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das wird besonders in ländlichen Gegenden und bei politisch engagierten Gruppierungen schnell zu Problemen führen. Denn auch im 21. Jahrhundert ist die Zensur noch nicht verschwunden, wie jüngst die Ereignisse rund um den TKI Open und den KUPF Innovationstopf beweisen.
Stimmen diese Gerüchte, dann plant ihre Regierung den größten Kahlschlag der unabhängigen Kunst- und Kulturszene der letzten Jahrzehnte.
Dies wäre ein Schlag ins Gesicht all jener, welche ihre kulturelle Arbeit als Arbeit an der Gesellschaft verstehen.
Dies wäre ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich tagtäglich zu Hungerlöhnen im österreichischen Kulturbetrieb verausgaben.
Dies wäre ein Schlag ins Gesicht all jener, die noch Hoffnung in den kulturpolitischen Gestaltungswillen der Sozialdemokratie haben.
In Österreich leben 73.900 Millionäre und 20.000 KünstlerInnen. Dass die Schnittmenge zwischen diesen beiden Gruppen eine minimale ist, wissen wir nicht erst seit der Studie über die soziale Lage der KünstlerInnen, die von ihrem eigenen Ressort in Auftrag gegeben wurde. 37% der KünstlerInnen leben unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze, gegenüber 13% der Gesamtbevölkerung. Es ist mir unverständlich, dass ausgerechnet die sozialdemokratische Partei weitere Kürzungen in dieser Bevölkerungsgruppe befürwortet.
Ich erwarte mir von Ihnen und von ihrer Partei, dass sie dafür kämpfen, die Zahl der Millionäre zu reduzieren.
Ich erwarte mir von Ihnen und von ihrer Partei, dass sie dafür kämpfen, die prekäre Lage der österreichischen KünstlerInnen und Kulturschaffenden zu verbessern.
2009 haben Sie angesichts der erschütternden Ergebnisse der oben erwähnten Studie zur sozialen Lage der KünstlerInnen gesagt: „Wir müssen handeln und ich als Kunst- und Kulturministerin bin dazu bereit.“ Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Versprechen der Sonntagsreden eingelöst werden müssen. Setzen Sie sich für die Anliegen jener Menschen ein, welche die kulturelle Vielfalt dieses Landes tagtäglich gestalten.
Mit den besten Grüßen,
Thomas Diesenreiter