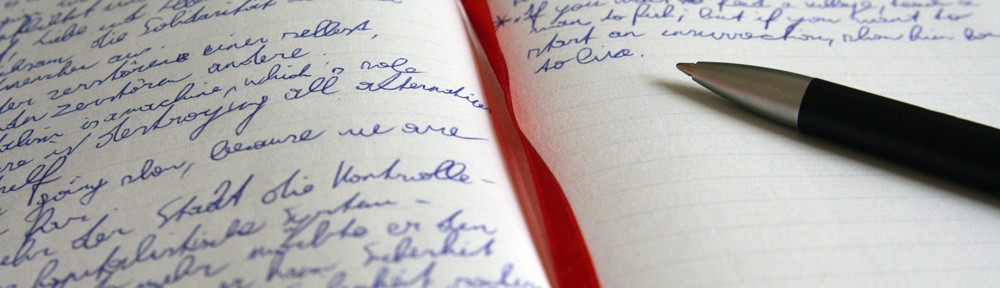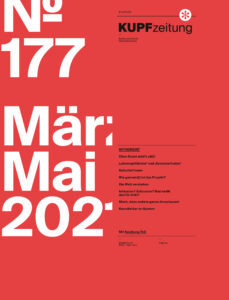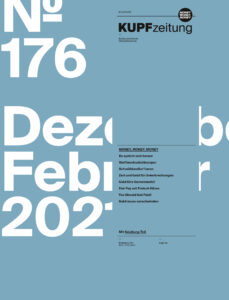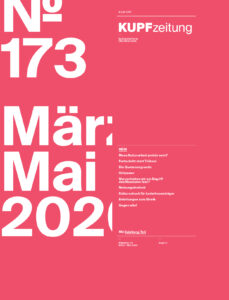Dieses Interview ist erstmals in der KUPFzeitung #177/2021 erschienen.
Thomas Diesenreiter: Sie mögen den Begriff der Subvention nicht, weil er die Tatsachen nicht richtig darstellt. Was wäre denn ein besserer Begriff?
Rudolf Scholten: Die Antwort ist einfach: ‚Öffentliche Finanzierung‘, wie für viele andere Bereiche auch. Universitäten werden öffentlich finanziert, der Gesundheitsbereich wird öffentlich finanziert, usw. Öffentliche Finanzierung ist der adäquate Ausdruck für einen Bereich, der nicht aus Unfähigkeitsgründen die Finanzierung im Markt nicht auftreibt, sondern öffentliche Finanzierung braucht, wie beispielsweise der gesamte Bildungsbereich. Ich glaube generell, dass für alle diese Diskussionen ein Vergleich mit der Wissenschaft, insbesondere der Grundlagenforschung, adäquat ist.
Warum haftet der Kultur-Finanzierung der Geruch von Almosen an, während das etwa bei Kindergärten oder im Straßenbau nie so kommuniziert wird?
Politisch gesehen gibt es keinen Grund, das ist einfach falsch, das haben wir uns falsch angewöhnt. Wenn Sie mich ‚privat‘ fragen, dann ist es wohl darin begründet, dass die anderen Bereiche kaum privat finanzierte Beispiele kennen. Grundlagenforschung ist immer öffentlich finanziert, Kindergärten sind nur in radikaler Minderheit privat finanziert. Aber im Kunstbereich stehen privat finanzierbare öffentlich finanzierten Beispielen relativ nahe. Warum wird im Film sehr viel kommerzieller diskutiert als im Theater? Weil im gleichen Kino kommerzielle Filme wie staatlich mitfinanzierte Filme gespielt werden. Es gibt aber kein Theater, in dem gleichzeitig Jelinek-Uraufführungen und Eisrevue stattfindet. Das mag lächerlich klingen, aber ich glaube, diese Nähe von kommerziellen und nicht kommerziellen Produkten in der Kunst ist größer als in anderen Bereichen. Das mag eine Begründung sein, aber keine Rechtfertigung, es deswegen falsch zu benennen.
Der Staat bzw. das Land hat ja den (Selbst-)Auftrag, seiner Bevölkerung ein Kunst- und Kulturangebot zur Verfügung zu stellen, sich um das kulturelle Leben zu kümmern. Nun könnten das Bundesland Oberösterreich oder andere Kommunen sagen: „Wir finanzieren ohnehin das Landesmuseum und die Landestheater, das reicht aus.“
Es braucht das gesamte Spektrum. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, die richtige Formulierung ist nicht so sehr, dass der Staat die Verpflichtung hat, das zu finanzieren, sondern die Gesellschaft es finanzieren will, weil sie versteht, dass sie es braucht. Da komme ich wieder zur Grundlagenforschung. Wenn Sie geschichtlich zurückblicken, werden Sie schnell bemerken, dass es eine große Parallelität zwischen Gesellschaften gibt, die bewusst in Kunst und Wissenschaft investieren und solchen, die auch in den pragmatischen wirtschaftlichen und politischen Bereichen erfolgreich sind. Die meisten der historisch erfolgreichen Gesellschaften waren sich sehr wohl bewusst. Sie haben verstanden, dass sie Kunst und Wissenschaft brauchen und daraus entstand der pragmatische politische und wirtschaftliche Erfolg. Würde man dies im Sinn der Umwegrentabilität spekulativ ansteuern, würde es mit Sicherheit nicht funktionieren.
Sie haben Anfang der 90er als Kulturminister erstmals auf Bundesebene ein breites Förderprogramm für Kulturvereine und Kulturinitiativen aufgelegt. Dieses gibt es bis heute in der Abteilung 2/7. Warum haben Sie das gemacht?
Lassen Sie es mich ganz einfach sagen: Wenn man Qualität will, muss man verstehen, dass das gesamte Spektrum notwendig ist: von dezentralen bis zentralen Organisationen, genauso wie von sehr riskanten Initiativen mit schmalem Aufmerksamkeitsgrad bis zu jenen mit einem breiten Angebot. Würde man einen Teil vernachlässigen, nimmt man bewusst in Kauf, dass die Wahrscheinlichkeit von Qualität sinkt.
Prinzipiell sind aber eigentlich die Bundesländer für die Kulturfinanzierung zuständig. Hat es damals also keinen Widerstand gegen dieses ‚Hineinregieren‘ des Bundes gegeben?
Aus Sicht der betroffenen Organisationen ist dieses Wechselspiel zwischen Bund, Land, Stadt oft mühselig. Zugleich muss man aus der praktischen Erfahrung sagen, dass diese Schaukel-Situation auch Vorteile produzieren kann. Der Bund kann zum Beispiel die Finanzierung für die Organisation X erhöhen unter der Voraussetzung, dass das Land mitzieht. Das Land würde es relativ leicht haben, nicht zu erhöhen, aber mit einer Zusage vom Bund und diesem zusätzlichen Druck tut es sich wesentlich schwerer.
Kultur, die politisch umstritten ist, hat dadurch auch ein bisschen größere Sicherheit, wie man in Kärnten sehen konnte, als Jörg Haider an die Macht gekommen ist und die Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur von einem Tag auf den anderen auf Null gefahren hat. Viele konnten nur durch das Geld aus dem Bund überleben. Demgegenüber steht trotzdem ein irrsinniger Verwaltungsaufwand.
Ich glaube, dass die politische Stabilität oder politische Sicherheit den bürokratischen Aufwand sticht, der zudem bereits wesentlich geringer geworden ist.
In der Kulturfinanzierung ist es üblich, dass KulturpolitikerInnen – Landes-, Kommunal- und StadtkulturreferentInnen – wirklich jede einzelne Förderentscheidung selbst bearbeiten. Wäre es nicht vielleicht notwendig, wie in der Wirtschaft – man denke an die AWS – eine unabhängige Kulturfinanzierungs-Organisation ins Leben zu rufen, die frei von politischer Einmischung Förderentscheidungen auf fachlicher – nicht politischer – Expertise trifft?
Die Antwort ist ja, bloß ist Ihre eigene Perspektive sehr stark geprägt von den Kulturinitiativen. Staatlicher Finanzierung muss eine politische Entscheidung zugrunde liegen in der Höhe des Budgets; die Einzelförderentscheidungen müssen ausgelagert sein.
Rudolf Scholten, ehemaliger Minister für Kunst, heute Präsident des Aufsichtsrats der Wiener Festwochen und des Österreichischen Filminstituts.